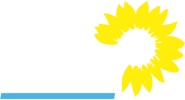DEMOKRATIE AUF SOLIDER BASIS
 Seit Anfang der 90er Jahre beschäftige ich mich mit der Thematik „direkte Demokratie“ und den Möglichkeiten, politischen Entscheidungen auf eine breitere Legitimationsbasis durch Bürger*innenbeteiligung zu stellen. Die Politiker*innen in der repräsentativen Demokratie sind dem Gemeinwohl verpflichtet, aber oft fehlt den Bürger*innen die Transparenz, wie die Entscheidungen zustande kommen, und damit das Vertrauen in die Beschlüsse. Politik scheint weit entfernt von der persönlichen Lebensrealität und wenig durchschaubar. Bürger*innenbeteiligung hat zum Ziel, bessere Entscheidungen mit höherer Akzeptanz in der Allgemeinheit sowie bei den Betroffenen zu erreichen. Schon Anfang der 90er Jahre wurden hierfür wissenschaftlich fundierte Ansätze von Politik- und Sozialwissenschaftler*innen entwickelt und sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene erfolgreich erprobt und angewendet. Ein Beispiel hierfür ist die Bürgerplanungszelle (Prof. Dienel, Wuppertal), bei der nach dem Zufallsprinzip Bürger*innen aus dem Wähler*innen-Register gezogen und in ein Planungsverfahren beratend (konsultativ) und entscheidend einbezogen werden.
Seit Anfang der 90er Jahre beschäftige ich mich mit der Thematik „direkte Demokratie“ und den Möglichkeiten, politischen Entscheidungen auf eine breitere Legitimationsbasis durch Bürger*innenbeteiligung zu stellen. Die Politiker*innen in der repräsentativen Demokratie sind dem Gemeinwohl verpflichtet, aber oft fehlt den Bürger*innen die Transparenz, wie die Entscheidungen zustande kommen, und damit das Vertrauen in die Beschlüsse. Politik scheint weit entfernt von der persönlichen Lebensrealität und wenig durchschaubar. Bürger*innenbeteiligung hat zum Ziel, bessere Entscheidungen mit höherer Akzeptanz in der Allgemeinheit sowie bei den Betroffenen zu erreichen. Schon Anfang der 90er Jahre wurden hierfür wissenschaftlich fundierte Ansätze von Politik- und Sozialwissenschaftler*innen entwickelt und sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene erfolgreich erprobt und angewendet. Ein Beispiel hierfür ist die Bürgerplanungszelle (Prof. Dienel, Wuppertal), bei der nach dem Zufallsprinzip Bürger*innen aus dem Wähler*innen-Register gezogen und in ein Planungsverfahren beratend (konsultativ) und entscheidend einbezogen werden.
Nach wie vor wehren sich viele Politiker*innen und Verwaltungen generell gegen informelle Beteiligungsverfahren, nicht nur, weil ja auch die Politiker*innen aus der Bürgerschaft gewählt worden sind und damit letztlich die Bürger*innen repräsentieren, sondern auch, weil die formelle Beteiligung in Plan-Verfahren bereits rechtlich verankert ist. Viele Politiker*innen und Verwaltungen sind daher der Ansicht, dass der Bürger*innenbeteiligung in Umfang und Zeitpunkt ausreichend genüge getan werde.
Dem widersprechen jedoch klar die Fakten: Zunehmende Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen, immer mehr von Frustration und Wut getragene Bürger*innenproteste und auf kommunale r Ebene immer mehr Bürger*innenentscheide gegen – zum Teil auch sehr sinnvolle und gute – kommunale Planungen. Letzeres ist besonders tragisch, wenn hierdurch für die Zukunft wichtige und sinnvolle Entwicklungen eine Kommune verzögert oder gänzlich blockiert werden. Dabei lässt sich klar belegen: Die Unzufriedenheit hat ihre Ursachen in als unzureichend empfundener, zu später Information und mangelnder Transparenz von Planungen, die dadurch ganz einfach nicht nachvollzogen oder verstanden werden können.
r Ebene immer mehr Bürger*innenentscheide gegen – zum Teil auch sehr sinnvolle und gute – kommunale Planungen. Letzeres ist besonders tragisch, wenn hierdurch für die Zukunft wichtige und sinnvolle Entwicklungen eine Kommune verzögert oder gänzlich blockiert werden. Dabei lässt sich klar belegen: Die Unzufriedenheit hat ihre Ursachen in als unzureichend empfundener, zu später Information und mangelnder Transparenz von Planungen, die dadurch ganz einfach nicht nachvollzogen oder verstanden werden können.
In meiner Diplomarbeit habe ich ein Planungsverfahren zur Sanierung einer bewohnten Industriealtlast in Nordrhein-Westfalen anhand zweier Beteiligungsmethoden, der Planungszelle und der moderierten Betroffenenbeteiligung (im Mediationsverfahren), wissenschaftlich begleitet und ausgewertet.
BETROFFENENBETEILIGUNG
Die reine Betroffenenbeteiligung ist die am wenigsten gut geeignete Methode der informellen Beteiligung bei Planungen, denn letztendlich sollen die Beschlüsse ja für die Allgemeinheit (also alle Bürger*innen) getroffen werden und nicht an einer speziellen Gruppe ausgerichtet sein. Betroffene sind jedoch in ihren ureigensten persönlichen Interessen berührt und sie vertreten daher, meist emotional aufgeladen, sehr individuelle Positionen. Dabei spielen weniger die Fakten rund um ein Vorhaben als persönliche Wertvorstellungen und die Übernahme von Meinungen eine wesentliche Rolle, Meinungen, die die eigene Haltung stützen, aber nichts mit Tatsachen zu tun haben müssen. Betroffene haben meist verfestigte und deshalb unverrückbar e Einstellungen zu einem Vorhaben: Sie wollen es in der Regel einfach nicht haben und mit allen Mitteln abwenden. Die Ängste und Befürchtungen Betroffener sind indes berechtigt, müssen in allen Verfahren ernst genommen und in Planungen angemessen berücksichtigt werden. Aber sie sollten nicht die Basis für wichtige Entscheidungen bilden. Fazit: Die reine Betroffenenbeteiligung ist – auch aus unserer Erfahrung als Beratungsbüro für Bürgerbeteiligung – nicht zielführend, weil dann meist das Eigeninteresse im Vordergrund steht und keine sachliche Ebene für einen Konsens gefunden werden kann.
e Einstellungen zu einem Vorhaben: Sie wollen es in der Regel einfach nicht haben und mit allen Mitteln abwenden. Die Ängste und Befürchtungen Betroffener sind indes berechtigt, müssen in allen Verfahren ernst genommen und in Planungen angemessen berücksichtigt werden. Aber sie sollten nicht die Basis für wichtige Entscheidungen bilden. Fazit: Die reine Betroffenenbeteiligung ist – auch aus unserer Erfahrung als Beratungsbüro für Bürgerbeteiligung – nicht zielführend, weil dann meist das Eigeninteresse im Vordergrund steht und keine sachliche Ebene für einen Konsens gefunden werden kann.
PLANUNGSZELLE
In der klassischen Variante von Planungszellen können sehr viele Bürger*innen über einen langen Zeitraum auch in überregionale Planungen einbezogen werden und die von den Bürger*innen erarbeiteten Beschlüsse sind nach der Vorstellung der Erfinder*innen dann auch bindend für die Politik. Diese Planungszelllen-Verfahren, die laut ihres Erfinders für die zufällig ausgewählten Wahlbürger*innen verpflichtend sein sollten, sind jedoch sehr kostspielig: Zum einen, weil hierfür sehr viel Vorarbeit von Expert*innen notwendig ist, und zum anderen, weil sie oft viele Monate oder gar Jahre andauern und die Bürger*innen dadurch persönlich durch den zeitlichen Aufwand belastet werden. Und es wurde festgestellt, dass durch eine von Bürger*innen getroffene Entscheidung nicht zwangsläufig höhere Akzeptanz v.a. bei den tatsächlich Betroffenen zur Folge hat. Die Methode wurde jedoch – wie viele andere Ansätze – ständig weiterentwickelt und situativ angepasst. Inzwischen gibt es für die Bürger*innenbeteiligung und den Bürger*innendialog viele den jeweiligen Planverfahren angepasste Formen und jahrelange Erfahrung – auch aus unseren Nachbarländern, z.B. Tirol und Vorarlberg.
BÜRGERWERKSTATT
Weitaus praxisnäher und sinnvoller als bei großen nationalen Infrastrukturplanungen Betroffene einzubinden ist es, die Bürger*innen auf der kommunalen Ebene abzuholen und sie stärker zu konsultieren und zwar nicht nur in der konkreten Vorhabenplanung, sondern bereits in der vorbereitenden Planung – also bei der künftigen Nutzung von Flächen eines Stadt- oder Gemeindegebietes. Das können z.B. künftige Nutzungen für Konversionsflächen sein oder die Überlegung, wo in der Kommune in Zukunft ein Gewerbegebiet angesiedelt, eine Senioreneinrichtung oder eine regenerative Energieversorgungsanlage errichtet werden könnte. Hier können ü ber einen längeren Zeitraum angeleitete Bürger*innenwerkstätten sinnvoll und das Wissen und die Erfahrung der Bürger*innen eine wertvolle Ressource für bessere Planungen sein. Die Anhörung Betroffener ist jedoch immer zu gewährleisten.
ber einen längeren Zeitraum angeleitete Bürger*innenwerkstätten sinnvoll und das Wissen und die Erfahrung der Bürger*innen eine wertvolle Ressource für bessere Planungen sein. Die Anhörung Betroffener ist jedoch immer zu gewährleisten.
BÜRGERDIALOG ALS POLITISCHE BILDUNG
Bei Vorhabenplanungen, wie z.B. der Gestaltung eines Platzes in einer Stadt, einem neuen Wohnuquartier, einer Anlage zur Energieerzeugung aus Erneuerbaren Energien oder einem Freizeitgelände, sind Bürgerdialog oder frühzeitige informelle Bürgerbeteiligung besonders wichtig. Hier stellt sich für die Verantwortlichen die Frage, welche Methode jeweils geeignet und sinnvoll ist: ob also zufällig ausgewählte Bürger*innen eingebunden werden oder eine offene Beteiligung von Interessierten mittels Werkstätten oder Befragungen und/oder zusätzlich digitale Informationen und Stimmungsbilder über ein spezielles Bürgerdialogportal.
Bei vielen Vorhaben einer Kommune soll und muss weit in die Zukunft gedacht werden und die Ergebnisse sind fast immer an irgendeiner Stelle mit Beeinträchtigungen für Einzelne verbunden. Hier ist eine hohe Neutralität der Betrachtung und eine starke Gemeinwohlorientierung notwendig. Bei großen Vorhaben sollten daher vor einer Minderheit aus stets aktiven, politisch Engangierten doch eher zufällig ausgewählte Menschen die Entscheidungen mit vorbereiten, damit eine höhere Repräsentativität und Akzeptanz gewährleistet wird.
Die wählten Bürger*innen sollen dabei ganz bewusst keine von einem Vorhaben betroffenen Bürger*innen sein, so dass ein neutraler, dem Gemeinwohl zuträglicher Blick auf die Sachlage und die bestehenden Optionen ermöglicht wird. Unter Anleitung von Expert*innen wird dann abgewogen und diskutiert, werden Lösungen gesucht und machbare Vorschläge unterbreitet. Diese werden den Politikern als Entscheidungshilfe an die Hand gegeben. Die von dem Vorhaben Betroffenen werden in diesen Verfahren angehört – ebenso wie in formalen Planverfahren die Träger*innen öffentlicher Belange, die Umwelt- und Naturschutzverbände und die Bürger*innen ihre Einwendungen vorbringen können.